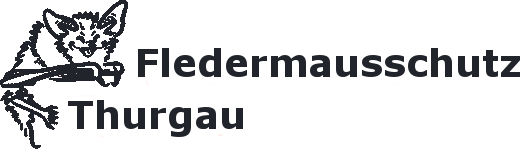Unsere Fledermäuse
Kleiner Abendsegler
Kleine Abendsegler – der kleine Bruder
Die Kleinen Abendsegler sehen dem „grossen Bruder“ ganz ähnlich. Sie sind aber nur halb so schwer und in der Rückenfärbung etwas dunkler. Auch der Kleine Abendsegler gehört zu den typischen Waldfledermäusen. Sie ziehen im Sommerhalbjahr ebenfalls bis hoch in den Norden. Als Wohnquartiere bevorzugen sie ausgediente Spechthöhlen und Fledermauskästen. Auch sie legen im Frühling und Herbst 1000 Kilometer in kurzer Zeit zurück. In der Regel gebären sie zwei Junge. In der Schweiz ist bisher keine Fortpflanzung nachgewiesen.
Sie ernähren sich von Stechmücken, Schnacken, Zuckmücken und anderen nacht- und dämmerungsaktiven Kleininsekten. Aber auch Eintagsfliegen, Florfliegen, kleine Nachtfalter und Netzflügler stehen auf ihrem Speiseplan.
Steckbrief:
Spannweite 26– 32 cm
Körperlänge ohne Schwanz 5 – 7 cm
Gewicht 13 – 20 g
Mittelgrosse, kräftige Fledermausart mit langen, spitzen Flügeln, schneller Flieger
Vorkommen im Thurgau:
In der Region Frauenfeld und Bischofszell beziehen sie im Herbst ihre Quartiere in Baumhöhlen und Fledermauskästen.
Text Franziska Heeb
Grosser Abendsegler
Grosse Abendsegler – der Rasante
Die Abendsegler fliegen bereits bei Sonnenuntergang aus. Sie gehören zu den schnellsten einheimischen Fledermäusen. Sie jagen gerne hoch über den Baumkronen, wo die Insektendichte hoch ist. Auch Waldränder und breite Flusslandschaften mit Feuchtgebieten lieben die Abendsegler. Im Frühling und Herbst legen sie auf ihren „Wanderungen“ in kurzer Zeit jeweils Hunderte von Kilometern zurück.
Sie ernähren sich von Köcherfliegen, Zuckmücken und anderen schwärmenden Kleininsekten. Mit ihrem kräftigen Gebiss können sie auch grosse Beutetiere wie Maikäfer und Falter fressen.
Den Sommer verbringen sie im nordöstlichen Teil von Europa, z.B. in Polen. Ihre Wochenstuben-Quartiere sind Baumhöhlen. Sie haben meistens zwei Junge pro Jahr. In der Schweiz wurde bisher keine Fortpflanzung nachgewiesen.
Steckbrief:
Spannweite 32 – 40 cm
Körperlänge ohne Schwanz 6 – 8 cm
Gewicht 20 – 40 g
Grosse, kräftige Fledermausart mit langen, spitzen Flügeln.
Vorkommen im Thurgau:
Grosse Kolonien finden wir zur Balzzeit im Herbst und auch im Frühjahr in den Regionen Frauenfeld, Kreuzlingen und Bischofszell. Sie überwintern bei uns in grossen Fledermauskästen, in Baumhöhlen, Felsspalten und Bauwerken.
Text Franziska Heeb
Zwergfledermaus
Normal 0 21 false false false DE-CH X-NONE X-NONE
Zwergfledermaus – die angeblich Häufigste
Bis zum Jahr 2000 galt die Zwergfledermaus als die kleinste einheimische Art. Seither hat ihr die Mückenfledermaus den Rang abgelaufen. Weil die Zwergfledermaus wohl in jedem Dorf angetroffen wird, ist man versucht, sie als die häufigste Art anzusehen. Genaue Kenntnisse darüber fehlen aber.
Da die Zwergfledermäuse ihre Quartiere oft wechseln, wird ihr Bestand vermutlich überschätzt. Die Zwergfledermaus besiedelt gerne enge Spalten an Gebäuden: Sie versteckt sich in Mauerverkleidungen, Zwischendächern, Rollladenkästen, Fassadenfugen und hinter Fensterläden.
Ihre Wochenstubenquartiere befinden sich in engen Spalten an Gebäuden. Sie haben ein oder zwei Jungtiere pro Jahr. Das Geburtsgewicht beträgt 1-2 g. Die Säugezeit dauert 4-5 Wochen.
Sie jagt entlang von Hecken, Waldrändern, Gehölzen und in Gärten nach kleinen Insekten. Ihr Flugverhalten ist sehr wendig. Mit dem Ultraschalldetektor können ihre lauten Ortungsrufe gut eingefangen werden.
Steckbrief:
Spannweite 18 – 24 cm
Körperlänge ohne Schwanz 3,5 – 5 cm
Gewicht 4 – 8 g
Sehr kleine Fledermausart, verbreitet.
Text Wolf-Dieter Burkard
Vorkommen im Thurgau:
Sie kommt über den ganzen Kanton verteilt vor. Weil sie oft in Häusern Quartier beziehen nimmt man oft ihren Kot wahr, der ihre Anwesenheit ankündigt.
Wasserfledermaus
Wasserfledermaus – die Flexible
Wasserfledermäuse sind leicht zu beobachten, da sie regelmässig und ausdauernd über Wasserflächen jagen, zum Beispiel über Weihern und breiten Flüssen. Eine einzelne Wasserfledermaus frisst pro Nacht mehrere Tausend kleine Insekten. Die Nahrungsmenge entspricht etwa einem Viertel bis einem Drittel des Körpergewichts.
Steckbrief:
Spannweite 24 – 27 cm
Körperlänge ohne Schwanz 4,5 – 5,5 cm
Gewicht 8 – 16 g
Mittelgrosse Fledermausart mit auffällig grossen Füssen, mit denen Insekten gefangen werden können.
Eigentlich eine Baumfledermaus, die aber auch Quartier in Bauwerken bezieht.
Stark an ruhige Gewässer wie Seen, Weiher mit freien Wasserflächen und breite Flüsse gebunden.
Vorkommen im Thurgau:
Die Wasserfledermaus besiedelt im Thurgau die verschiedensten Quartiere: warme Dachböden, kühle Burgkeller, unterirdische Bachläufe, Brückengewölbe, Baumhöhlen und Vogelnistkästen. Die grösste Kolonie mit weit über 1000 Tieren lebt in einem geräumigen Estrich mitten in Kreuzlingen. Es handelt sich um eine Wochenstube mit über 700 erwachsenen Weibchen.
Text Wolf-Dieter Burkard
Mückenfledermaus
Mückenfledermaus – die Kleinste
Sie ist die kleinste heimische Fledermausart. Erst 1995 wurde erkannt, dass in Europa unter dem Begriff „Zwergfledermaus“ zwei selbständige Arten zusammengefasst wurden: Die Zwergfledermaus und die Mückenfledermaus. Letztere wurde im Jahr 2000 erstmals im Thurgau nachgewiesen.
Sie besiedeln gerne enge Spaltquartiere, zum Beispiel Zwischendächer in hohen und zum Teil neuen Gebäuden. Ihre bevorzugten Jagdgebiete scheinen Flachwasserzonen zu sein. Hier jagen sie über dem Wasser kleine Insekten.
Ihre Wochenstubengesellschaften haben sie meist in engen Spalten an Gebäuden. Sie gebären ein bis zwei Junge pro Jahr. Geburtsgewicht 1-2 g, Säugezeit 3-4 Wochen.
Steckbrief:
Spannweite 17 – 23 cm
Körperlänge ohne Schwanz 3 – 5 cm
Gewicht 3 – 8 g
Vorkommen im Thurgau:
Im Thurgau lebt eine grosse Population Mückenfledermäuse bekannt. Sie konzentriert sich offenbar auf die Bodenseeregion mit Schwerpunkt Kreuzlingen. Hier sind bis jetzt 12 Wochenstuben nachgewiesen. Eine zweite, etwas kleinere Population lebt im Raum Romanshorn. Am Obersee und Untersee jagen sie über den Flachwasserzonen dem Ufer entlang.
Text Wolf-Dieter Burkard
Weissrandfledermaus
Weissrandfledermaus – die Eingewanderte
Die Weissrandfledermaus liebt die Wärme. Kaum verwunderlich, dass sie im Tessin eine häufige auftretende Art ist. Sie wohnt gerne in ländlichen Siedlungen und in städtischen Strukturen. Sie jagen beim Eindunkeln regelmässig um Strassenlaternen. Sie besiedelt Hohlräume unter Wandverkleidungen, in Zwischendächern oder Rollladenkästen. Aber auch in Mauerritzen, Baumhöhlen und Fledermauskästen können wir sie antreffen.
In den Wochenstubenkolonien sind ungefähr 20 Weibchen, die regelmässig Zwillinge zur Welt bringen.
Sie jagt im Flug kleine Insekten wie Eintagsfliegen, Köcherfliegen, kleine Falter und Zuckmücken.
Text Franziska Heeb
Steckbrief:
Spannweite 21 – 22 cm
Körperlänge ohne Schwanz 4– 5 cm
Gewicht 5 – 10 g
Kleine Fledermausart mit gelbbraunem Fell und deutlich weissen Streifen am Rand der Flughaut.
Wochenstubengesellschaften im Thurgau in engen Spalten an Gebäuden
Oft zwei Junge pro Jahr
Jagt gerne in Siedlungen nach kleinen Insekten
Text Wolf-Dieter Burkard
Vorkommen im Thurgau:
1996 wurde das erste Exemplar im Thurgau nachgewiesen. Zurzeit sind Vorkommen der Art im Thurtal und entlang des Bodensees von Tägerwilen bis Romanshorn bekannt.
Rauhautfledermaus
Rauhautfledermaus – die Weitgereiste
Obwohl sie zu den kleinsten Fledermausarten gehört, legt die Rauhautfledermaus die weitesten Entfernungen zurück. Zwischen ihren Sommerquartieren im Norden Europas und den im Südwesten gelegenen Winterquartieren können Distanzen bis zu 2000 km liegen. Eine in Engishofen TG gefundene Rauhautfledermaus war in Lettland beringt worden. Normalerweise bringen die Weibchen der Art ihre Jungen im nördlichen Europa zur Welt. In Etzwilen TG befindet sich die einzige Wochenstube der Schweiz.
Steckbrief:
Spannweite 23 – 25 cm
Körperlänge ohne Schwanz 4,5 – 5,5 cm
Gewicht 5 – 13 g
Kleine Fledermausart
Wanderfreudig, Fortpflanzung in Nordeuropa, oft zwei Junge pro Jahr
Jagt in Wäldern nach kleinen Insekten
Überwintert oft in Holzstapeln, erträgt die Kälte
Text Wolf-Dieter Burkard
Vorkommen im Thurgau:
Im Februar 2016 wurde in Frauenfeld eine Rauhautfledermaus gefunden, die im September 2015 in Dresden beringt wurde.
Grosses Mausohr
Grosses Mausohr – die Grösste
Das Grosse Mausohr ist die grösste bei uns vorkommende Fledermausart. Sie sind typische Dachstock fledermäuse. Sie jagen in Wäldern und auf frisch gepflügten Äckern nach bodenbewohnenden Insekten. Mit ihren grossen Ohren orten sie auch ohne Ultraschall ihre Beute anhand der Krabbelgeräusche. Sie jagen über dem freien Boden, landen kurz um die Beute zu fangen und fliegen mit ihr davon. Mausohren können mehr als 10 Kilometer weit vom Tagesschlafquartier bis ins Jagdgebiet fliegen. Den Winter verbringen sie in Höhlen, Kellern und Stollen. Im Winterschlaf sind sie hilflos und jedes Stören und Aufwachen bedeutet für sie einen enormen Energieverlust. Damit ihre Fettreserven bis in den Frühling ausreichen, sind sie darauf angewiesen, dass wir sie nicht stören. Deshalb sollten Höhlen mit winterschlafenden Mausohren durch Gitter vor uns Eindringlingen geschützt werden.
fledermäuse. Sie jagen in Wäldern und auf frisch gepflügten Äckern nach bodenbewohnenden Insekten. Mit ihren grossen Ohren orten sie auch ohne Ultraschall ihre Beute anhand der Krabbelgeräusche. Sie jagen über dem freien Boden, landen kurz um die Beute zu fangen und fliegen mit ihr davon. Mausohren können mehr als 10 Kilometer weit vom Tagesschlafquartier bis ins Jagdgebiet fliegen. Den Winter verbringen sie in Höhlen, Kellern und Stollen. Im Winterschlaf sind sie hilflos und jedes Stören und Aufwachen bedeutet für sie einen enormen Energieverlust. Damit ihre Fettreserven bis in den Frühling ausreichen, sind sie darauf angewiesen, dass wir sie nicht stören. Deshalb sollten Höhlen mit winterschlafenden Mausohren durch Gitter vor uns Eindringlingen geschützt werden.
Steckbrief:
Spannweite 35 – 43 cm
Körperlänge ohne Schwanz 6,5 – 8 cm
Gewicht 20 – 40 g
Die Wochenstuben sind frei sichtbar im Gebälk des Dachstockes.
Die Männchen sind meist einzeln und verborgen in Dachstöcken.
Sie gebären im Juni oder Juli und haben nur ein Junges pro Jahr. Ihr Geburtsgewicht liegt bei 6 g und ihre Säugezeit beträgt 4-6 Wochen.
Sie sind stark gefährdet.
Text Franziska Heeb
Vorkommen im Thurgau:
Von dieser einst im Kanton offenbar häufigen Art sind nur noch drei Wochenstuben bekannt: Sie befinden sich in den Kirchen Lipperswil und Ermatingen sowie in einem Privathaus in Pfyn.
Diese Fledermausart wird im Thurgau intensiv überwacht. Ihre Bestände werden seit über 25 Jahren regelmässig erfasst. Die Zählungen geben Anlass zur Hoffnung: Alle drei Kolonien haben sich nach einem Tiefstand erholt. Es geht den Grossen Mausohren, für welche man das Aussterben befürchtete, wieder besser. Allerdings stagnieren die Bestände seit einigen Jahren ohne erkennbare Ursache.
Bestandesentwicklung in den drei thurgauischen Wochenstuben des Grossen Mausohrs
|
|
1988 |
1996 |
2002 |
2006 |
2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lipperswil |
100 |
270 |
280 |
240 |
230 |
|
Ermatingen |
40 |
100 |
100 |
90 |
90 |
|
Pfyn |
20 |
40 |
60 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
total |
160 |
410 |
440 |
430 |
420 |
Die Werte geben jeweils die maximale Anzahl der im Quartier gezählten erwachsenen Weibchen an. Es zeigt sich, dass sich der Bestand nach dem Tief in den Achtziger Jahren erholt hat, nun aber seit fast zwanzig Jahren stagniert.
In allen drei Wochenstuben wurden anstehende Renovationsarbeiten durch die Koordinationsstelle fachlich begleitet und so negative Auswirkungen auf die Fledermäuse verhindert. Die Ursachen für die stagnierenden Bestandeszahlen müssen ausserhalb der Quartiere gesucht werden: Zu geringe Nahrungsmengen? Zu verstreute Jagdgebiete und deshalb zu energieaufwändig?
Weil Grosse Mausohren nur ein Junges pro Jahr gebären, wachsen die Kolonien selbst unter günstigen Voraussetzungen nur langsam. Der stärkere Zuwachs Ende der Achtziger Jahre könnte auch ein Hinweis auf andernorts zerstörte Quartiere sein.
Text Wolf-Dieter Burkard
Braunes Langohr
Braunes Langohr – die Gefährdete
Das braune Langohr steht wie die andern beiden Langohrarten auf der roten Liste und ist stark vom Aussterben bedroht. Besonders im dicht besiedelten Mittelland sind die Bestände stark rückläufig. Zurzeit startet eine detaillierte Untersuchung der Langohr-Quartiere, um den Ursachen auf den Grund zu gehen und um die nötigen Schutzmassnahmen anzuordnen. Das Braune Langohr bewohnt gerne offene Dachstöcke in Bauernhäusern. Auch wenn wir sie nur sehr selten zu Gesicht bekommen verrät ihr Kot im Dachstock ihre Anwesenheit. Die Langohren leben in kleinen Kolonien von bis zu 30 Tieren.
Ihre Jagd beginnen sie erst bei völliger Dunkelheit. Sie meiden Strassenlaternen und beleuchtete Objekte. Da sie mit ihren Ultraschallrufen nur max. 15 m weit hören, sind sie auf Strukturen wie eine Hecke oder grosse Obstbäume angewiesen. Nur in speziellen Ausnahmefällen überfliegen sie flaches, leeres Ackerland.
Sie bringen ein Jungtier pro Jahr zur Welt, doch nur 20% davon überleben den ersten Winter.
Der Ausbau und das Isolieren von alten Dachstöcken gehört zu den Hauptursachen für das Verschwinden des Braunen Langohrs. Die grosse Lichtverschmutzung um das Quarteier herum und die Rodung von natürlichen Hecken lassen die noch verbleibenden Quartiere verwaisen. Wenn wir jetzt nicht handeln, verschwindet diese Fledermausart womöglich ganz.
Sie ernähren sich von Nachtfalten und Ohrwürmern, die sie von Blättern und der Rinde ablesen. Sie lieben das Jagen in Hochstamm-Obstkulturen lesen aber auch fleissig die Insekten von Hagelnetzen der Niederstammkulturen ab.
Steckbrief:
Spannweite 24 – 28 cm
Körperlänge ohne Schwanz 4 – 5,5 cm
Gewicht 5 – 10 g
Vorkommen im Thurgau:
Alle einst aufgenommenen Langohrquartiere werden in den nächsten 1-3 Jahren von den ausgebildeten Fledermausschützern kontrolliert, um den genauen Bestand zu erfassen.
Text Franziska Heeb